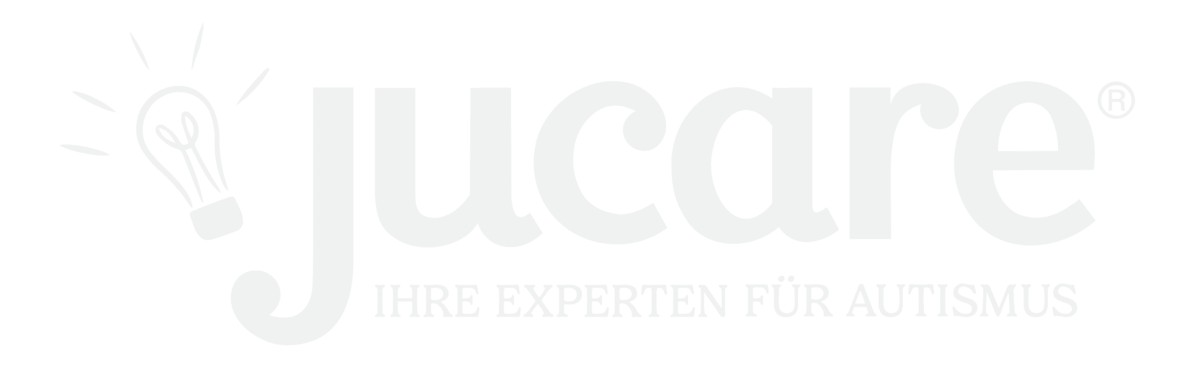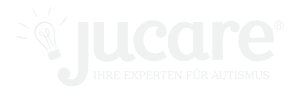Meltdown oder Wutanfall? So erkennen und handeln Lehrkräfte im Schulalltag
Manchmal kippt eine eigentlich ruhige Unterrichtssituation plötzlich: Ein Kind hält sich die Ohren zu, wirft Hefte vom Tisch, wirkt nicht mehr ansprechbar. Viele fragen sich dann, ob das ein Wutanfall ist. Häufig handelt es sich jedoch um einen Meltdown, also eine Überlastungsreaktion, die insbesondere bei Kindern im Autismus-Spektrum auftreten kann. Der Unterschied ist entscheidend, denn er bestimmt, wie wir sinnvoll reagieren.
Meltdown vs. Wutanfall: der Kernunterschied
Ein Wutanfall entsteht meist, weil ein Wunsch nicht erfüllt wird. Das Kind verfolgt ein Ziel und hat in gewissem Maße Kontrolle über sein Verhalten. Ein Meltdown dagegen ist keine bewusste Entscheidung. Er entsteht durch starke Überforderung, etwa durch Lärm, grelles Licht, unvorhergesehene Planänderungen oder soziale Überreizung. Kinder erleben dann einen Kontrollverlust. Ermahnungen, Diskussionen oder Strafen verschlimmern die Situation eher.
Typische Hinweise auf einen Meltdown
- Auslöser sind sensorische oder organisatorische Reize und nicht primär Frustration
- Das Kind wirkt nicht mehr ansprechbar und kann sich selbst schwer regulieren
- Die Reaktion kann auch ohne Publikum auftreten und länger anhalten
Prävention im Klassenzimmer
Gute Prävention beginnt beim Lernumfeld. Hilfreich sind eine klare Tagesstruktur, visuelle Hinweise wie Stundenpläne, angekündigte Übergänge und feste Rituale. Lärmquellen lassen sich dämpfen, und eine ruhige Rückzugsecke hilft vielen Kindern beim Entlasten. Unterstützte Kommunikation, zum Beispiel Bildkarten, einfache Gebärden oder Apps, können Missverständnisse reduzieren und Selbstwirksamkeit stärken. Wichtig ist, dass Lösungen individuell abgestimmt werden. Nicht jedes Kind braucht dieselben Reize oder Hilfsmittel.
Akut richtig reagieren
Wenn ein Meltdown entsteht, steht Sicherheit an erster Stelle. Bewahren Sie Ruhe, sprechen Sie leise und vermeiden Sie viele Worte. Reduzieren Sie Reize, etwa indem Sie das Licht dimmen, Fenster schließen oder die Klasse kurz aus dem Raum führen. Bieten Sie dem Kind, wenn möglich, einen ruhigeren Ort an und bleiben Sie in respektvoller Distanz präsent. Körperliche Fixierung ist zu vermeiden, außer es besteht akute Gefahr. Schuldzuweisungen oder Strafen sind fehl am Platz, denn das Kind kann sein Verhalten in diesem Moment nicht willentlich steuern.
Nachbereitung und Lernschleife
Ist das Kind wieder ansprechbar, hilft eine kurze, wertschätzende Nachbesprechung. Was hat überfordert, was hat geholfen, was könnten wir beim nächsten Mal anders machen. Nutzen Sie dafür je nach Bedarf einfache Sprache, Visualisierungen oder Bildkarten. Stimmen Sie sich mit Eltern, Schulbegleitung und Kollegium ab und halten Sie wirksame Strategien fest. Wiederkehrende Auslöser lassen sich so gezielt entschärfen, etwa durch angepasste Sitzordnung, Gehörschutz, vorab angekündigte Planänderungen oder kurze Entlastungszeiten.
Sensibel sprechen, gemeinsam handeln
Sprache prägt Haltung. Sprechen Sie von Kindern mit Autismus statt über “die Autisten”. Beschreiben Sie Verhalten als Signal einer Überforderung, nicht als Absicht. Das nimmt Druck aus der Situation, stärkt Beziehungen und öffnet den Weg zu Lösungen , die allen in der Klasse zugutekommen.
Fazit
Wer Meltdowns von Wutanfällen unterscheiden kann, reagiert schneller, ruhiger und wirksamer. Struktur, Vorhersehbarkeit, Reizreduktion und abgestimmte Kommunikation sind die besten Werkzeuge. So wird der Unterricht für Kinder mit und ohne Autismus sicherer und lernfreundlicher.
Mehr Sicherheit im Umgang mit herausfordernden Situationen im Schulalltag gewünscht? Die JuCare Akademie bietet Fortbildungen für Lehrkräfte, Schulbegleitungen und Fachkräfte an.
Quellen
Autismus-Kultur. „Autistische Kinder in der Schule.“ 2023.
Autismus-Kultur. „Autistische Wahrnehmung: Praxistipps.“ 2022.